Woher kommt das Gute?
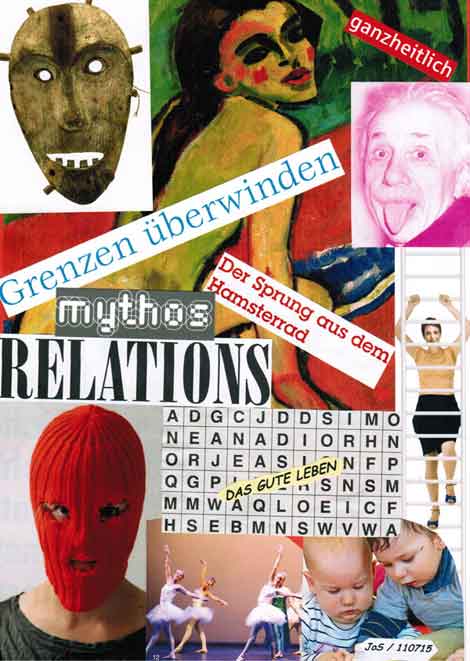 Collage, zusammengestellt von Dr. Jos Schnurer
Collage, zusammengestellt von Dr. Jos Schnurer
Bild anklicken zum Vergrößern
Kommt es von „Oben“, wie das Sprichwort verspricht? Kommt es geplant oder zufällig? Ist das Gute das Alltägliche oder Besondere? Oder ist das Gute Lust und Last? Wir versuchen diese Fragen nicht aus der magischen Glaskugel zu lesen, auch nicht, indem wir sie abwartend „aussitzen“, oder sie erzwingen wollen. Vielmehr geht es darum, die Frage nach dem Guten im menschlichen Dasein als eine der wesentlichen philosophischen Bemühungen zu artikulieren. In der aristotelischen Philosophie wird tagathon, das Gute, vom kakon, dem Schlechten, unterschieden. Es ist die Tugend des Gutseins, die eine Haltung repräsentiert, die vom individuellen Eigenen ausgehend sich an Andere(s) richtet, und zwar sowohl in hedonistischer, als auch in moralischer Hinsicht. Eu zên, das gute Leben, ist gleichzeitig ein gelingendes und glückliches Dasein und schließt ein gutes Denken und Handeln ein. Die Grundannahme der verschiedenen philosophischen Zugänge zum Guten geht von der anthropologischen Überzeugung aus, dass der anthrôpos, der Mensch, kraft seines Verstandes und seiner Vernunftbegabung daraufhin angelegt ist, gut sein zu wollen. Das Problem, das sich zwischen dem Gutsein-Wollen und dem Guttun auftut, hat im philosophischen Diskurs immer schon zu einer kontroversen Auseinandersetzung geführt. “Du redest anders, als du handelst!“, dieser Vorwurf, den der römische Philosoph Lucius Annaeus Seneca (ca. 1 – 65 n. Chr.) ins Feld führte[1], wie auch der Zwiespalt, auf den der florentinische Staatsphilosoph Niccolò di Bernardo Machiavelli (1469 – 1527) in seinem Werk „Il Prinzipe (1513) aufmerksam machte: „Denn zwischen dem Leben, wie es ist, und dem, wie es sein sollte, klafft ein so gewaltiger Unterschied, dass wer das, was man zu tun aufgibt für das, was man tun sollte, eher seinen Untergang als seine Erhaltung bewirkt: denn ein Mensch, der immer nur Gutes tun wollte, muss zugrunde gehen unter so vielen, die nicht gut sind“. Sein heute eher als Pragmatismus anmutender Rat, „zu lernen, auch nicht gut zu sein, und das Gute zu tun und zu lassen, wie es die Notwendigkeit erfordert“, klingt beinahe „vernünftig“, sollte aber bei den Herausforderungen der Globalisierung kritisch betrachtet werden Das Dilemma wird deutlich: Gut zu sein ist anstrengend, denn es gibt nicht das absolute eine Gute[2]. Zwischen dem Objektivierbaren und dem subjektiven Empfinden gibt es sowohl unüberwindliche Mauern, als auch begehbare Brücken. Im Diskurs um die Suche nach objektiven Bewertungskriterien und Qualitätsstandards, etwa bei Prüfungskommissionen, wird der irritierende wie gleichzeitig wahre Satz formuliert: „Das einzig Objektivierbare ist die Subjektivität“[3].. Wir sind angelangt bei dem Problem, das gleichzeitig eine Chance darstellt, nämlich bei der Frage, „wie Realität entsteht“[4]. Es sind die eigenen, kulturell tradierten und gesellschaftlich gesetzten Erwartungshaltungen und Einstellungen zu den Werten und Tugenden, in denen das Gute im Menschen deutlich wird. Zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte haben sich Gut und Böse die Waage gehalten, hat das eine überwogen und ist das andere unterlegen. Und der jeweilige Zustand und die Entwicklungen wurden weltanschaulich oder ideologisch begründet und damit handhabbar und selbstverständlich für das individuelle und gesellschaftliche Leben der Menschen gemacht. Nicht selten aber auch ergeben sich aus der Reflexion und dem Nachdenken über vergangenes Gutes oder Böses Zielsetzungen oder Abschreckungen für das gegenwärtige und zukünftige Leben. Dabei spielt das kollektive Erinnern als Fähigkeit des Denkens eine große Rolle: „Wenn man mit dem Gedächtnis tätig ist, sagt man in der Seele, dass man in der Vergangenheit etwas wahrgenommen oder gelernt hat“[5]. In der sich immer interdependenter und entgrenzender entwickelnden (Einen?) Welt haben Gutes und Böses nicht nur lokale, sondern globale Auswirkungen. Der lapsige Spruch: „Was geht mich an, wenn in China eine Schaufel umfällt!“ ist nicht nur aus egozentrischen Gründen abzulehnen, sondern auch aus existentiellen[6]. Ein individueller und gesellschaftlicher, lokaler und globaler Perspektivenwechsel ist gefordert, soll in der Gegenwart und Zukunft eine humane, gerechte, friedliche Menschheit existieren können. Die Weltkommission „Kultur und Entwicklung“ hat diese Herausforderung auf den Punkt gebracht: „Die Menschheit steht vor der Herausforderung umzudenken, sich umzuorientieren und gesellschaftlich umzuorganisieren, kurz: neue Lebensformen zu finden“[7].
Was ist der Mensch?
Der anthrôpos, der Mensch, ist, so lernen wir bereits seit der griechischen Antike, ist eine „durch seine Zweibeinigkeit charakterisierte Gattung der Lebewesen“. Durch seine Vernunft- und Sprachbegabung habe er Anteil am unvergänglichen und göttlichen Geist. Durch seine aufrechte Körperhaltung stehe er auf der obersten Stufe der scala naturae und nehme dadurch eine Mittelstellung zwischen Gott und Tier ein. Er sei fähig, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, Allgemeinurteile zu fällen und sittlich zu handeln. Diese Frage wird philosophisch, anthropologisch, ethisch, moralisch, biologisch, psychologisch… über die Jahrtausende menschlichen (Nach-)Denkens hinweg immer wieder kongruent und konfrontativ diskutiert und analysiert, und in der neueren Zeit in verstärktem Maße auch neurologisch erforscht. Die Frage, ob der Mensch des Menschen Freund sein könne oder Wolf sein müsse, bestimmt das abendländische Denken. Nicht zuletzt mit der Beantwortung dieser Kontroverse hängt zusammen, welche ethischen und moralischen Einstellungen sich als Lebens- und Verhaltensnormen in einer Gesellschaft entwickeln und gelebt werden sollen. Spätestens seit der von den Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 proklamierten „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“, die als allgemeingültige und nicht relativierbare „globale Ethik“ in das Menschheitsbewusstsein implementiert wurde, wird die „Menschenwürde“ als Fundament eines friedlichen, gerechten und gleichberechtigten Zusammenlebens der Menschen auf der Erde gesetzt: „Die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte bildet die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt“[8] Der aufrechte Gang, als physiologisches Phänomen, wird in der Evolutionstheorie als entscheidende Entwicklungsstufe des anthrôpos hin zum homo sapiens angesehen. Gleichzeitig mit der biologischen Bestimmung wird die physiologische Bedeutung dieser evolutionären Entwicklung hervorgehoben, was sich z. B. in zahlreichen Sprichwörtern und Deutungen zeigt („Wer sichere Schritte tun will, muss sie langsam tun“, Goethe), in Liedern Aufforderungscharakter hat („Wann wir schreiten Seit´ an Seit´“, programmatisches Lied der sozialdemokratischen Arbeiterjugend) und in der Literatur und Kunst in vielfältiger Weise bearbeitet wird; oder zum Ausdruck kommt in Ehrungen, etwa wenn die Humanistische Union den Bürgerrechtspreis „Aufrechter Gang“ auslobt, oder sich Vereine und Bürgerinitiativen den Namen „Aufrechter Gang“ geben. Der an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster Praktische Philosophie lehrende Kurt Bayertz stellt fest, dass im Denken der Menschen zwar die Bedeutung des aufrechten Gangs in vielfachen Formen präsent ist; dass aber eine „Geschichte des aufrechten Gangs“ aus anthropologischer und philosophischer Sicht bisher nicht vorliegt. Dies will er mit seinem Buch ändern. Er will damit aufzeigen, welche verschiedenen Interpretationen die Tatsache des menschlichen aufrechten Gangs über die Jahrhunderte hinweg vorgenommen wurden, danach Ausschau halten, wie diese Deutungen in den jeweiligen historischen und kulturellen Zusammenhang gestellt wurden und dadurch die Hauptentwicklungslinien des anthropologischen Denkens aufzeigen. Die Geschichte vom aufrechten Gang (des Menschen) aus anthropologischer Sicht wird zur Geschichte des anthropologischen Denkens. Kurt Bayertz legt eine spannende, interdisziplinäre, alltagsfähige und intellektuell anspruchsvolle Betrachtung über die Tatsache vor, dass der Mensch mit seinem aufrechten Gang mehr ist als ein anderes Tier auf zwei Beinen. Dabei begibt er sich zum Glück nicht auf die gefährlichen, ideologischen und fundamentalistischen Gleise eines „allmächtigen“ Menschseins, sondern bleibt auf der Straße des „Natürlichen“. Damit zeigt er Perspektiven auf, die die Fähigkeit des aufrecht Gehens des Menschen nicht nur als physische, körperliche Fähigkeit notiert, sondern insbesondere als evolutions- und geistesgeschichtliche Entwicklung – und damit auch als Herausforderung – präsentiert![9].
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“
In diesem simplen, aber logischen Spruch von Erich Kästner werden Dilemma und Chance eines guten Lebens deutlich. In der Spannweite, die sich im kontroversen Paar „Tun und Unterlassen“ für den menschlichen Diskurs zeigt, werden Fallstricke, Sackgassen, Wegegabelungen, aber auch die Richtungen bei der philosophischen Nachschau nach den Bedeutungen und Wirkungen menschlichen (Nicht-)Handelns deutlich. Sie zeigen sich bereits, wenn man dem Volk aufs Maul zu schaut, in den Sprichwörtern nämlich, wie: „Achte nicht bloß auf das, was andere tun, sondern auch auf das, was sie unterlassen!“ – „Alles Tun zu seiner Zeit!“ – „Jedermann recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann!“. Der Philosoph und Ethiker von der Universität Düsseldorf, Dieter Birnbacher, hat 2015 ein Buch neu aufgelegt, das er bereits 1995 veröffentlicht hat. Er fragt darin nach den moralischen, gesellschaftlichen und juristischen Zugängen zu den Tugenden des Tuns und Unterlassens. In der Auseinandersetzung mit dem Begriffspaar „Tun“ / „Unterlassen“ geht es um „die Tendenz, Tun und Unterlassen, Handeln und Geschehenlassen, aktives Eingreifen und passives Untätigbleiben moralisch deutlich verschieden zu beurteilen“. Er belegt dies mit der Erfahrung, die auch ein Sprichwort sein könnte: „Wer einen anderen vorsätzlich belügt oder betrügt, indem er ihm Märchen auftischt, wird gemeinhin strenger moralisch verurteilt als wer einen anderen durch das Verschweigen wichtiger Tatsachen wissentlich im Irrtum lässt“. Mit den philosophischen, juristischen und ethischen Überlegungen über „Tun und Unterlassen“, die der Autor vor 20 Jahren in den gesellschaftlichen Diskurs gebracht hat und jetzt die Gesellschaft erneut mit einer Neuauflage konfrontiert, erinnert er daran, „dass der Grund für die moralische Differenzierung zwischen ansonsten vergleichbaren Handlungen und Unterlassungen nicht in dem bloßen Umstand liegen kann, dass in dem einen Fall ein Handeln, im anderen ein Unterlassen vorliegt“; es kommt vielmehr darauf an, die „durchgängige ( ) Gültigkeit der normativen Handlungs-Unterlassungs-Differenzierung“ kritisch zu hinterfragen“[10].
Gutsein ist tugendhaft sein
Die Frage nach den Tugenden, die Menschen haben, zumindest anstreben sollten, wird im philosophischen Denken immer wieder gestellt. Der griechische Philosoph Platon weist vier Kardinaltugenden aus: Besonnenheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit und Weisheit. Aristoteles unterscheidet dianoetische und ethische Tugenden, die sich jeweils entweder aus dem gemeinschaftlichen Dasein der Menschen ergeben, oder durch ein gutes Handeln bestimmt sind. Nach der Nikomachischen Ethik ist die ethische Tugend eine Haltung, „die von Entscheidung getragen ist und in einer Mitte für uns besteht, die durch die Vernunft bestimmt wird“. Der römische Kirchenlehrer Hieronymus sieht die Laster benachbart zu den Tugenden. In Sprichwörtern und Aphorismen werden die Tugenden gelobt und die Laster verurteilt, und es wird kritisiert und sich lustig gemacht über die oftmals vergeblichen Bemühungen, ein „tugendhafter Mensch“ zu sein, ahnend, dass sich das unvollkommene Lebewesen Mensch zwischen den gegensätzlichen Polen von Gut und Böse, Altruismus und Egoismus, Ordnung und Unordnung hin- und her bewegt. Anzustrebende Tugenden als Haltungen und Charakteristika eines Individuums sind immer auch Rufe nach Ordnungen und Gewissheiten in der sich immer interdependenter, entgrenzender und unsicher werdenden (Einen?) Welt[11]. Über deutsche Tugenden gibt es Vermutungen und Gewissheiten, Spekulationen und Illusionen, Ideen und Ideologien. Sie werden als Spiegelbilder veranschaulicht und als Zerrbilder dargestellt, sie entwickeln sich als Typen und Stereotypen. Die legitime und notwendige Frage: „Wer bin ich?“ wird nicht selten zum Irrlicht bei dem Unterfangen, Eigenschaften von Bevölkerungsgruppen und Völkern als Tugenden und Untugenden herauszufiltern. In der Geschichte der Menschheit hat es immer wieder Versuche gegeben, so genannte Charaktereigenschaften zu benennen, die ein Volk kennzeichnen: Der Deutsche ist …, die Italiener sind…, der Asiate…, der Afrikaner…, der Jude… In Befragungen und soziologischen Studien werden Vor- und Einstellungen von Menschen eines Landes oder einer Region zu denen in anderen Ländern und Kontinenten verglichen. Die dabei entstehenden Tabellen markieren Sympathie und Antipathie zu anderen Völkern. Sie stellen sich allzu oft als Vorurteile heraus, die in einer Mehrheitsgesellschaft und Kultur gemacht und tradiert werden[12]. Tugenden fallen nicht vom Himmel. Sie werden zwar, soweit es sich um religiös motivierte Haltungen handelt, als Gebote gesetzt und kritisiert; doch um sie im individuellen und gesellschaftlichen Leben zu entwickeln und wirksam werden zu lassen, bedarf es der Reflexion und des Gebrauchs des Verstandes. So ist es durchaus sinnvoll, die Frage nach den „deutschen Tugenden“ zu stellen, wie sie in der eigenen Wahrnehmung und durch Menschen aus anderen Kulturen gesehen werden. Der promovierte Historiker, Unternehmensberater und Ethnologe Asfa-Wossen Asserate gilt als einer, dem es gelingt, seine Beobachtungen als Äthiopier zu verbinden mit denen eines seit mehr als vierzig Jahren in Deutschland Lebenden. Sein interkultureller Blick auf die deutschen Befindlichkeiten ist deshalb nicht nur ein oberflächlicher und vorübergehender, sondern ein gefestigter und intimer. Mit gutem Recht kann er sagen: „Ich gehöre zu euch, auch als deutscher Staatsangehöriger, und deshalb erlaubt mir, dass ich euch und uns beobachte, anschaue und frage: Was sind deutsche Tugenden?“[13].
Heißt Gutsein kompromissfähig zu sein?
Die Fähigkeit, mit seinem Hoffen, Wollen und Tun ein Ergebnis zu erreichen, das dem Eigenen wie dem Anderen wohl will, zeichnet den zôon politikon, das politische Lebewesen Mensch (Aristoteles) aus. Dabei steht der Kompromiss an oberster Stelle. Damit sind wir dann auch schon bei der Erkenntnis, dass es sich dabei um einen äußerst mehrdeutigen Begriff handelt, und der „Kompromiss“ vom „faulen Kompromiss“ unterschieden werden muss; und zwar in unserem Fall nicht in erster Linie bei der individuellen, sondern der politischen Betrachtung. Weil aber ein Kompromiss eine Brücke über die Schlucht zwischen Frieden und Gerechtigkeit darstellt, ist zu unterscheiden zwischen einem guten, einem schlechten und einem faulen Kompromiss. Während der erstere wünschenswert und hilfreich für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben der Menschen ist, stellt der zweite möglicherweise eine in der jeweiligen Situation hinnehmbare Entscheidung dar, während der dritte als eine absolut unannehmbare und unakzeptable Haltung betrachtet werden muss. Kompromisse als Mittler zwischen dem unabdingbaren Nein und dem unbedingten Ja gilt es zu suchen, weil es notwendig ist, die Extreme zu erkennen und zu entlarven: Sektierertum auf der einen und Fundamentalismus auf der anderen Seite. Der israelische Philosoph Avishai Margalit verweist auf die Zusammenhänge, wie politische Kompromisse zustande kommen, wie sich das Gute und Humane des Kompromisses darstellt, und wie „faule Kompromisse“ zustande kommen und wirken. Als ob die Lettern, die Margalit über Kompromisse und faule Kompromisse schreibt, leuchten wollten in den heutigen Tag und unsere Wirklichkeit hinein, erscheint der Bericht über das kürzliche Konzert Daniel Barenboims im Gaza-Streifen, bei denen der Maestro sich an das begeisterte Publikum wendet – „Wie ihr wisst, bin ich ein Palästenser“ (Beifall brandet auf). „Ich bin aber auch ein Israeli“ (und tatsächlich wird wieder geklatscht). „Ihr seht also, es ist möglich, beides zu sein“[14]. Es zeigt sich als ein aktuelles Exempel für die Anwendung eines politischen Kompromisses zum Wohle von Völkern. „Über Kompromisse und faule Kompromisse“ von Avishai Margalit macht deutlich, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Denk- und Handlungswerkzeuge zur Unterscheidung von (legitimen und guten) Kompromissen und faulen (illegitimen und unzulässigen) Kompromissen hilfreich ist, das eigene politische Bewusstsein zu stärken und so, als zôon politikon, dazu beizutragen, ein demokratisches Gemeinwesen zu schaffen[15].
In Würde leben
„Die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte (bildet) die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt“. Diese in der Präambel der von den Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 proklamierten Allgemeinen Erklärung zuvorderst postulierte Definition des Menschseins und der in Artikel 1 eindeutig gesetzte Grundsatz – „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen“ – gelten als globale Ethik und Verpflichtung für alle Menschen. Grundlegende, gesetzte, erworbene und „gefühlte“ Werte und Normen, die ein gerechtes und friedliches Zusammenleben aller Menschen auf der Erde fordern und regeln wollen, unterliegen freilich immer auch der Misere, dass die dabei implizierten Annahmen von Einsicht, Verantwortungsbewusstsein und Friedfertigkeit allzu oft nicht vorhanden sind und von Egoismen, Opportunismen und Nationalismen überlagert werden. Die aristotelische Auffassung, dass der Mensch ein zôon politikon, ein politisches Lebewesen ist, das aufgrund seiner Vernunft- und Sprachbegabung nicht nur in der Lage, sondern auch gewillt ist, ein gutes, gelingendes Leben für sich und alle Menschen anzustreben, hinkt hinter den Ansprüchen und Wirklichkeiten hinter her[16]. Der Philosoph Peter Bieri nimmt den seit Jahrtausenden in unterschiedlichen Zusammenhängen und Positionen geführten Diskurs um Menschenwürde auf. Er setzt erst einmal das metaphysische und philosophische Verständnis voraus, das hinter den Würdebegriff steht und definiert Würde „als eine bestimmte Art und Weise, ein menschliches Leben zu leben … (als) ein Muster des Denkens, Erlebens und Tuns“. Er geht davon aus, dass ein wacher und genauer Blick auf die vielfältigen Lebenserfahrungen genügt, um diesem ethischem Wert auf die Spur zu kommen. Er nähert sich der Herausforderung, indem er drei Fragen stellt: Wie werde ich von anderen Menschen behandelt? – Wie behandle ich andere Menschen? – Wie stehe ich zu mir selbst?. Es sind fraglos philosophische Fragen nach dem Kantischen Dreischritt: „Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen“. Diese Prämissen lassen sich in Gebote meißeln, in Gesetze gießen oder in Verfassungen schreiben. Damit können sie sich zu Richtschnüren oder Fesseln entwickeln. Es könnte aber auch gelingen, die Würde des Menschen als ein Wagnis zu verstehen, als eine Herausforderung, die im tagtäglichen Denken und Tun sich ausbreitet, konfrontiert und als Hindernis oder gar als Falle auftut. Der Autor nähert sich der Problematik dadurch, dass er feststellt: „Unser Leben als denkende, erlebende und handelnde Wesen ist zerbrechlich und stets gefährdet – von außen wie von innen. Die Lebensform der Würde ist der Versuch, diese Gefährdung in Schach zu halten“[17].
Leben ist eines der schwierigsten!
Weil beim Leben immer auch das Risiko mitspielt! Oder ist Leben eines der natürlichsten Dinge der Welt? Mit solchen Fragen scheinen wir Menschen uns immer wieder schwer zu tun! Denn einerseits bringen alltäglich zum Bewusstsein, dass Ungewissheiten, Unsicherheiten und Krisen unser Leben beeinflussen, stören und bestimmen – so dass die Weltrisikogesellschaft eine globale Verantwortungsethik, eine transnationale Gemeinsamkeitsethik, eine globale Gewaltenteilung und Zusammenarbeit erforderlich machen- andererseits, weil Risiko überall ist und jeweils unterschiedlich wahr genommen und erlebt wird[18], dass das Denken und Handeln bei Risiken individuell und kollektiv mit differenzierten Strategien angegangen werden müssen[19] ; auch dass es einer aktiven Einsicht und einer präsenten Wachheit und Bedrohungssensibilität in den modernen Gesellschaften bedarf[20]. Beim Versuch, Risiken zu erkennen, einschätzen und mit ihnen umgehen zu lernen, bietet sich dabei zum einen die wissenschaftliche Analyse an, mit der etwas festgestellt und bewertet wird, um die Diagnose in einem Gutachten, einem Regelwerk, einem Gesetz oder einer Handlungsanweisung umzusetzen; oder (und) das Wagnis einzugehen, sich bei einem gemeinsamen Entdeckungsprozess und Dialog auf die Suche nach der individuell und gesellschaftlich passenden und adäquaten Risikokompetenz zu begeben. Der Psychologe, Direktor des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und des Harding-Zentrums für Risikokompetenz, Gerd Gigerenzer, hat sich bereits mehrmals zu Wort gemeldet, wenn es um den richtigen Umgang mit Zahlen, Statistiken und Risiken (2002) und um Fragen nach Unbewusstem und Intuitivem bei menschlichen Entscheidungen geht (2007). Er ist als Coach und Trainer bei politischen Entscheidungsträgern und für gesellschaftliche Prozesse Verantwortlichen tätig. Allerdings: Er setzt sich nicht „aufs hohe Ross“ und glaubt, mit seiner Expertenmeinung könne er die Fähigkeit der Menschen beeinflussen oder steigern, Risiken vermeiden zu können. Vielmehr macht er sich auf den Weg, anhand von einleuchtenden, eher alltäglich erscheinenden Beispielen und Erfahrungen aufzuzeigen, dass
- jeder den Umgang mit Risiko und Ungewissheit lernen kann (weil er in verständlicher Sprache deutlich und Mut macht, sich des eigenen Verstandes zu bedienen),
- Experten(meinungen) eher ein Teil des Problems als die Lösung sind (weil er verständlich macht, dass die Fähigkeit, Risiken zu verstehen, meist nicht mit Expertisen zu vermitteln ist),
- weniger mehr ist (weil er zu erklären vermag, dass Problemlösungen nur selten komplex und allumfassend möglich sind)[21].
Menschliche Bedürfnisse und Schlüsselerlebnisse
Der US-amerikanische Psychologe und Präsident der „American Psychological Association“, Abraham H. Maslow (1908 – 1970), gilt als Mitbegründer der Humanistischen Psychologie[22]. Maslow ist in der deutschsprachigen, psychologischen, psychotherapeutischen, soziologischen und entwicklungspolitischen Diskussion vor allem durch seine „Bedürfnispyramide“ bekannt geworden, mit der er die individuellen Grundbedürfnisse der Menschen aufzeigt und Fragen danach stellt, welche Grundbedürfnisse der Mensch benötigt und Forderungen nach sozialer und Verteilungsgerechtigkeit stellt. Bei der Suche nach Menschlichkeit drehte er die bis dahin in der Psychologie und Psychotherapie gewohnte Fragestellung „Was macht Menschen psychisch krank?“ einfach um und fragte: „Was zeichnet psychisch besonders gesunde Menschen aus?“. Mit dem aufregenden, anthropologischen und psychologischen Perspektivenwechsel erkennt er, dass jeder Mensch ein Mystiker und in der Lage ist, nach einem guten, gelingenden Leben zu streben. Mit den Fragen – „Eine wie gute Gesellschaft erlaubt die menschliche Natur?“, und „Eine wie gute menschliche Natur erlaubt die Gesellschaft“ – holt er transzendentes Denken und Erleben auf die Erde und die Alltagswelt der Menschen zurück: „Der Mensch besitzt eine höhere und transzendente Natur, und sie ist Teil seines Wesens, d. h. seiner biologischen Natur als Mitglied einer Gattung, die der Evolution entsprungen ist“[23]
Menschliches Bewusstsein
„cogito ergo sum“ („ich denke, also bin ich“), so drückte der französische Philosoph und Naturwissenschaftler René Descartes (1596 – 1650) das Wissen über sich selbst aus, wobei er auswies, dass der Mensch sich seiner Gedanken unmittelbar bewusst sei, während er die Dinge, die von der Außenwelt auf ihn einwirken, nur unmittelbar aufnehme.Es zeigt sich also bereits in dieser frühen philosophischen Zuordnung, dass unser Bewusstsein Bestandteil unseres Geistes und damit unseres individuellen Daseins ist. „Ohne Bewusstsein ist die persönliche Sichtweise aufgehoben, wir wissen nichts von unserer Existenz, und wir wissen auch nicht, dass irgendetwas anderes existiert“. Die existentielle Frage „Wer bin ich?“, die jeder Mensch sich stellt und stellen muss, ist ja für die eigene wie die kollektive Identität die Grundlage für das Menschsein und die Menschlichkeit. Es ist eine philosophische und alltägliche Frage; und die Antworten darauf stellen sich als Selbstverständlichkeiten wie Überraschungen und Entdeckungen dar. Wie aber entsteht unser Bewusstsein? Auch auf diese Frage gibt es philosophische Antworten wie Vermutungen. Eine der Antworten lautet: Aus unserem bewussten Geist. Was aber unser Geist ist, lässt sich wiederum nicht messen und schon gar nicht anschauen; denn unseren Geist spüren wir nur selbst von unserem Innern heraus. Die Vermutung, dass unser Geist in unserem Gehirn entsteht, ruft – neben den Philosophen – diejenigen auf den Plan, die unser Gehirn als ein Organ kennen: Die Neurologen und Psychologen. Der portugiesische Neurowissenschaftler von der University of Southern California, António R. Damásio, setzt sich in seinem Buch „Selbst ist der Mensch“ mit zwei spannenden Fragen auseinander: „Wie baut das Gehirn einen Geist auf?“ und „Wie sorgt das Gehirn in diesem Geist für Bewusstsein?“. Damasios Forschungen zum Bewusstsein gehen auf Konfrontation zu der bisherigen, durch Descartes überkommenen Postulate, dass es eine Trennung zwischen Körper und Geist gebe; er geht vielmehr davon aus, dass ein konstitutiver Zusammenhang zwischen Körper und Geist bestehe und sich die Eigenschaften des Denkens und Fühlens ständig gegenseitig beeinflussten. Die Forscher sind dem Geheimnis des menschlichen Bewusstseins weiterhin auf der Spur. „Das Geheimnis des Bewusstseins“, sagt Antonio Damasio, „ist nach wie vor ein Geheimnis, auch wenn wir ein wenig weiter vorgedrungen sind“[24].
„An wen glauben wir eigentlich oder hängen unser Herz?“
Hat das Streben nach kapitalistischem Wohlstand, nach einem materialistischem Immer-Mehr-Verlangen etwas mit Spiritualität, mit der Suche nach und dem Aufgehobensein in Religiosität zu tun? Das ist eine uralte, immer wieder neu gestellte, kontrovers diskutierte und bisher nicht eindeutig beantwortete Frage; es sei denn, sie wird individuell, kollektiv, kulturell oder ideologisch postuliert; damit aber ist sie zwar diskutier-, aber eben nicht allgemeingültig beantwortbar. Es geht hier nicht um den durchaus lebhaften und legitimen Diskurs darüber, ob es einen Gott oder keinen gibt[25]; eigentlich auch nicht um die berechtigte Frage, ob der Mensch „nicht nur das politische Wesen von Aristoteles, nicht nur nach Hobbes des Menschen Wolf, sondern vielmehr von Anbeginn an ein soziales und religiöses Wesen“ ist und damit um die interessante und intellektuelle Fragestellung, ob Reden über Religion eine existentiell bedeutsame Herausforderungen für uns Menschen darstellt, oder (nur) ein ideologischer Ballast ist[26] - vielmehr wird hier die durchaus herausfordernde und existentielle Frage danach gestellt, wie sich ein humanes, ganzheitliches und nachhaltiges Bewusstsein in der sich immer interdependenter, entgrenzender (und ungerechter?) entwickelnden (Einen?) Welt bilden kann[27]. Es ist die Frage nach den allgemeingültigen und verbindlichen Menschenrechten, nach Freiheit, Gerechtigkeit und Individualität[28]. Wir sind angelangt bei der Frage der Fragen: Ist es unsere Gier nach dem scheinbaren „guten Leben“, das nicht mehr und nicht weniger ist als nach dem ökonomischen „MehrWert“ und sich orientiert an der Alternative „Gott oder Geld“ und „Gott und Geld“? Oder ist es die Kraft der Widerständigkeit? Wohin? Es ist das ethische, (planetarische?), wissenschaftliche Bewusstsein nach unserer Endlichkeit[29] und dem ökonomischen Dasein. Es ist die Auseinandersetzung mit der Krisenhaftigkeit des menschlichen Daseins, das wissenschaftlich allein nicht fachbezogen und existentiell weder einheitlich noch einfältig diskutiert noch beantwortet werden kann, sondern der ethischen, theologischen, ökonomischen, (religions-)pädagogischen, sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Nachfragen bedarf. Je nach Positionierung der jeweiligen Leit(frage-)disziplin wird sich auch der interdisziplinäre Diskurs vollziehen. Die Evangelischen Hochschulperspektiven, ein Forschungsverbund der Evangelischen Hochschulen Darmstadt, Freiburg/Br., Ludwigsburg und Nürnberg, bringen seit 2005 jeweils einen Jahresband heraus, in dem sie sich „über die Grenzen der eigenen Disziplin hinaus … verständigen und Antworten auf drängende Fragen … finden (müssen), in unserer Zeit der Finanz-, Banken- und Schuldenkrise in der nachhaltiges Handeln nicht nur in Politik gefordert ist, sondern auch Gegenstand von Lehre und Forschung an unseren Hochschulen sein muss“. Der Rechts- und Verwaltungswissenschaftler von der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, Richard Edtbauer und Alexa Köhler-Offierski geben den achten Jahresband mit dem umschreibenden Titel „Welt – Geld – Gott“ heraus. Die im Sammelband präsentierten Beiträge aus dem Diskussions- und Forschungsverbund der „Evangelischen Hochschulperspektiven“ zum Jahresthema 2012 „Welt – Geld – Gott“ bieten einen Einblick in den (religions-) wissenschaftlichen Diskurs zu ethischen, theologischen, ökonomischen, religions-pädagogischen, sozialen und gesundheitswissenschaftlichen Grundaussagen und Fragestellungen darüber, wie wir Hier und Heute die lokalen und globalen gesellschaftlichen Entwicklungen bewerten und nachhaltig mitgestalten können. Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler praktizieren, in Forschung, Entwicklung und Lehre (FEL), eine interdisziplinäre Kommunikation und beanspruchen, „Antworten auf drängende Fragen ( ) in unserer Zeit der Finanz-, Banken- und Schuldenkrise… (zu finden)“ – und nicht zuletzt danach zu suchen, wie unser Verhältnis zu „Geld und Gott“ so gestaltet werden kann, dass es human, also menschlich ist[30].
„Begriff und Wert der Autonomie in Wissenschaft, Kunst und Politik“
Der heftige, kontroverse, theoretische und praktische Diskurs in den Sozialwissenschaften über die Formen und Zuschreibungen zum Autonomiebegriff, und in diesem Zusammenhang zu den Modernisierungstendenzen hin zu „flachen Hierarchien“, scheint sich von den Flachgewässern und sumpfigen Gebieten bis zu den Untiefen der Existenznachschau zu vollziehen. Die Paradigmen, wie sie sich zu den Bestandsaufnahmen und Analysen über Freiheit und Gemeinschaft, Normativität und Kritik, Wahrheit und Ideologie, Recht und Subjektivität, Kapitalismuskritik und Klassenkampf und Politische Praxis Hier und Heute darstellen, verweisen ja einerseits darauf, dass mit dem traditionellen Begriff der Autonomie eher Beziehungslosigkeit und Isolation entstehen, die wiederum zu Einschränkungen bei den Ansprüchen für eine autonome Lebensführung führen[31], andererseits zeigt sich an der Kritik am traditionellen Autonomie-Paradigma, dass sich der Mensch als homo faber durch denkendes Tun erschafft und entwickelt. Kooperation verbessert die Qualität des sozialen Lebens. Darin steckt der Gedanke: Global denken, lokal handeln. So lässt sich Gemeinschaft als ein „Prozess des In-die-Welt-Kommens vorstellen, in dem die Menschen den Wert direkter persönlicher Beziehungen und die Grenzen solcher Beziehungen herausarbeiten“[32] In der von der Wilhelms-Universität in Münster herausgegebenen Zeitschrift ZTS (Theoretische Soziologie) wird Autonomie als einerseits abgeschriebener, überholter, andererseits als aktuell moderner und perspektivenreicher Begriff diskutiert. Insbesondere in der Soziologie führen Fragestellungen nach der Bedeutung von Autonomie für soziale Daseinsformen und -existenzen dazu, den normativen, öffentlichen Begriffsverwendungen deskriptive und analytische Beschreibungen entgegen zu setzen. Das erfolgt zum einen dadurch, Autonomie als gesellschaftlichen Wert zu definieren; zum anderen aber – und das in zunehmendem, engagiertem Maße – werden Theorie- und Praxisfragen danach gestellt, wie Autonomie konzeptionell gefasst ist und Autonomiegewinne und- verluste empirisch zu ermitteln sind[33].
„Vertrauen haben“,
als ethische und moralische Charaktereigenschaft hat im philosophischen, gesellschaftlichen und individuell-alltäglichen Denken und Handeln einen hohen Stellenwert. „Vertrauen ist ein Phänomen, das… Komplexität reduzieren kann und Kooperation erleichtert oder überhaupt erst möglich macht“ – diese Lesart steckt in den Gewissheiten, mit denen wir eine vertrauensvolle Einstellung verbinden und einfordern für alle individuellen, lokalen und globalen Lebensbedingungen der Menschen auf der Erde[34]. Diese humane Fähigkeit zeigt sich in allen Lebenslagen, wird wirksam im alltäglichen, individuellen und gesellschaftlichen Leben der Menschen, und besonders bedeutsam in existentiellen und politischen Krisensituationen[35]. Die Historikerin und Direktorin des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Ute Frevert, legt mit „Vertrauensfragen“ ein Buch vor, mit dem sie, wie im Untertitel formuliert „eine Obsession der Moderne“ konstatiert. Sie will den Begriff nicht nur beim Wort nehmen, sondern die vielfältigen Bedeutungen, Anwendungsformen und intellektuellen wie alltäglichen Ausprägungen historisch und aktuell herausarbeiten. Das ist kein l´art pour l´art – Unternehmen, sondern eine notwendige Auseinandersetzung, weil insbesondere der Vertrauensbegriff im alltäglichen, gesellschaftlichen und politischen Leben Anwendung findet, wo es sinnvoll und weiterführend wäre, wirklich danach zu fragen: „Was ist Vertrauen?“ – und „Meint der andere, der die Vertrauensfrage stellt, damit das gleiche wie ich?“. Sie begibt sich auf der klitschige Feld des Bedeutungswandels des Begriffs und der Handhabung des Begriffs, indem sie semantisch, historisch und aktuell die Bedeutung von „Vertrauen“ analysiert und Tendenzen aufzeigt, die es erleichtern, die Akte von Vertrauensforderungen und -beweisen zu verstehen und einschätzen zu können. Dass sie in diesem Zusammenhang auf den Begriff „good governance“ verweist, zeigt zudem, dass eine individuelle und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Tugend „Vertrauen“ lokal und global dringend notwendig ist[36].
Wie kann der Mensch souverän und ohne Angst verschieden sein?
Festschriften entstehen aus unterschiedlichen Motiven. Sie können „Pflichtübungen“ sein oder „Bedürfnisse“. Letzteres dürfte zutreffen, wenn wir den Sammelband „Verschieden sein“ betrachten, der von Wegbegleiter_innen, Kolleg_innen und Freund_innen der Basler Philosophin und Genderforscherin Andrea Maihofer zu ihrem 60. Geburtstag zugeeignet wird. In den Zeiten, in denen Begriffe wie „Heterogenität“ ganz oben auf der Agenda eines Weltgeschehens stehen, dass sich immer interdependenter, entgrenzender, verunsichernder und ungerechter gestaltet und Differenzerfahrungen als Irritation der eigenen kulturellen Anschauungen schafft[37], in denen „Verletzlichkeiten“ sogar gekonnt filmisch dargestellt werden und der Wunsch nach individuellen und gesellschaftlichen Veränderungen in der Luft liegt[38], in denen die „Commons-Community“ zum Perspektivenwechsel gegen das ökonomische und existentiell-gefährdende Immer-Mehr-Immer-Schneller-Immer-Höher aufruft und als Alternative gegen den Wachstumswahn in der Welt „Teilen ist Mehr wert“ stellt[39], in denen die Mahnungen nicht fehlen, die fortschreitenden Prekarisierungen begünstige nationalistisch-ausgrenzende Orientierungen[40], in denen Anklagen gegen die vielfältigen Unmenschlichkeiten in der Welt zuhauf zu hören sind[41], in denen die Berichte zur Lage der Welt sich von Jahr zu Jahr katastrophaler anhören, in denen die Fragen nach den Ordnungen in der Welt immer drängender werden[42], in denen die Ausbreitung von Fundamentalismen, Nationalismen und Traditionalismen Thema in der Gesellschafts- und Politikanalyse ist, usw. usf., bedarf es der Versicherung über die menschlichen Erwartungshaltungen und Perspektiven, die entweder gründen auf den pessimistischen, naturrechtlichen Auffassungen, dass der Mensch des Menschen Wolf sei (Titus Maccius Plautus / Thomas Hobbes), oder darauf, dass er ein zôon politikon, ein politisches Lebewesen sei, das mit Verstand und dem Willen zu einem „guten Leben“ ausgestattet und darauf angewiesen ist, in Gemeinschaft mit Menschen zu leben (Aristoteles). Die Fragen, die sich zu den jeweiligen Positionen stellen, orientieren sich dabei in gleicher Weise daran, wie die Verschiedenheiten der Menschen betrachtet und philosophisch und praktisch ausgelegt werden. Die Beiträge, wie sie im Sammelband, der zu Ehren von Andrea Maihofer von ihren Schüler_innen und Kooperationspartner_innen geschrieben werden, fokussieren auf der Maihoferschen Frage: „Wie kann der Mensch ohne Angst verschieden sein“. Die Antworten darauf sind eindeutig: Wenn es gelingt zu erkennen, dass „unser Denken, Wahrnehmen, Fühlen und Handeln immer schon ein vergesellschaftlichtes und vergeschlechtlichendes ist und welche Bedeutung dies hat“. Es dürfte gelungen sein, die unterschiedlichen Reflexionen, Fragestellungen und Weiterführungen der von Andrea Maihofer und ihren Apologeten entwickelten gesellschaftskritischen Theorien und Modellbildungen aufzufächern und weiter zu entwickeln[43].
Gehorsamkeit ist die Unterwerfung des eigenen Willens unter den eines anderen
Die Wortbedeutung „Gehorsam“ unterliegt gesellschaftlichen, kulturellen und ideologischen Bedingungen, wie sich dies in Sprichwörtern, Volksliedern, politischen Programmen, in Theaterstücken und in der Literatur ausdrückt; da wird „militärischer Gehorsam“ vom Soldaten gefordert; das Kind soll den Eltern gehorchen; die Gläubigen von Religionsgemeinschaften sollen die religiösen Gebote befolgen;; von „Gehorsamspflicht“ wird gesprochen, wenn es darum geht, die Gesetze einzuhalten, die für ein Gemeinschaftsleben notwendig sind; und „Kadavergehorsam“ wird bezeichnet, wenn jemand seinen eigenen Verstand und seine Kritikfähigkeit an Regeln abgibt, die andere Autoritäten aufstellen und einfordern. Die Auseinandersetzung mit dem Begriff und die Einstellung muss also differenziert geführt werden: Eine „solidarische Gehorsamkeit“, bei der eigene, egoistische Erwartungshaltungen zugunsten von gesellschaftsförderlichen und demokratischen Zielsetzungen und Perspektiven zurückgestellt werden, ist ohne Zweifel anders zu bewerten, als eine an die herrschende Macht und Ideologie abgegebene Anpassung. Unser Verständnis von Demokratie, Selbstbestimmung und freiheitlichem Denken und Handeln ist ja eingemeißelt in die „globale Ethik“, wie die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte postulierte humane Menschheitsdefinition bezeichnet wird: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen“. Da ist keine Rede davon, dass ein Mensch dem anderen untertan sein soll, dass einer bestimmen und der andere gehorchen soll, dass ein Mensch sich vor einem anderen bücken soll; dass es Herrenmenschen und Knechte geben sollte… Vielmehr lebt Demokratie von kritischen, gleichberechtigten Bürgerinnen und Bürgern. Es geht hier nicht um Anarchie, also um die Ablehnung von Werten und Normen, die für ein friedliches, gerechtes, humanes Zusammenleben der Menschen in einer Gesellschaft und in der Weltgesellschaft unverzichtbar und geboten sind, sondern um den kritiklosen, blinden Gehorsam, der den Menschen zum Werkzeug für Machtausübung degradiert und dadurch zu einer leeren Hülle des Gehorchens macht. Der 1923 in Berlin geborene, 1936 in die USA emigrierte und seit 1979 in der Schweiz lebende, lehrende und praktizierende Psychoanalytiker Arno Gruen, ist auf dem deutschen Fachbüchermarkt kein Unbekannter. Seine Bücher mit den bezeichnenden Titeln – „Dem Leben entfremdet“, „Der Fremde in uns“, u. a. – verdeutlichen, worum es ihm geht, nämlich aufzuzeigen, dass „das Bedürfnis nach Gehorsam ( ) ein grundlegender Aspekt unserer Kultur (ist)“, und es notwendig ist, uns bewusst zu machen: „Wir leugnen sogar, moderne Sklaven und Knechte des Gehorsams geworden zu sein“. Damit schlägt er den Boden von der etymologischen und philosophisch-existentiellen Auseinandersetzung um den Begriff „Gehorsam“ hin zur aktuellen, lokalen und globalen, lebensweltlichen Bedeutung. Er knüpft damit an sein Konzept von der „Kultur der inneren Autonomie“ an, das er in seinem Buch „Der Kampf um die Demokratie“ (2002) dargelegt hat und als Prozess der Selbstfindung verstanden werden kann. „Das Problem des Gehorsams“ identifiziert er als einen pathologisch zu bezeichnenden Aspekt unserer kulturellen Identitätsfindung. Das zeigt er an einer Reihe von Beispielen auf und plädiert dafür, die Bestandteile des in unserer Kultur eingelegten kritiklosen, blinden Gehorsams aufzudecken[44]. Es sind eher kurzgefasste Gedankensplitter und Denkanregungen, mit denen Arno Gruen argumentiert. Sie fordern die eigene Denkanstrengung und die intellektuelle, differenzierte Auseinandersetzung mit der Bewertung heraus, dass Gehorsam destruktiv ist: „Gehorsam grenzt das Denken ein und verneint die Realität“. Mit seinem Rat, ganzheitlich denken zu lernen, entwickelt er eine Vision: „Eine bessere Welt wird sichtbar, wenn der verblendete Gehorsam aufgebrochen wird und sich in echte zwischenmenschliche Empathie verwandelt“[45].
„Die Anforderungen an die Verantwortlichkeit wachsen proportional zu den Taten der Macht“,
diese Anmahnung von Hans Jonas (Warum die moderne Technik ein Gegenstand für die Ethik, in: Hans Jonas, Technik, Medizin und Ethik, Frankfurt/M. 1987, S. 45-48), ist heute aktueller denn je – angesichts der sich in den Zeiten der vielfältigen Umwelt-, Klima-, Finanz-, Wirtschafts-, Technik- und humanen Katastrophen deutlicher artikulierenden Frage: Darf der Mensch alles machen, was er kann? Die individuellen und lokal- und globalgesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Frage, wie Macht entsteht, ausgeübt wird, notwendig und schädlich ist, Recht bewirkt und Unrecht erzeugt hat im öffentlichen Freiheits- und Individualitätsdiskurs einen hohen Stellenwert. Die Frage, inwieweit Macht auch Widerstand hervorruft, gewissermaßen Formen der Resistenz erzeugt, die sich in vielfältiger Weise ausdrücken und zu Tage treten - „mögliche, notwendige, unwahrscheinliche, spontane, wilde, einsame, abgestimmte, kriecherische, gewalttätige, unversöhnliche, kompromissbereite, interessierte oder opferbereite Widerstände“. Foucaults vielfältiges Bemühen, politisches Denken und Handeln der Menschen in der Geschichte und Gegenwart aufzuspüren und zu analysieren, lässt sich im „plebejischen Moment“ erkennen, als „Wunsch, das Spezifische, das Gefährliche des gegenwärtigen Augenblicks in den herrschenden Machtbeziehungen, in der Normalität aufzufinden[46]. Der an der Kieler Christian-Albrechts-Universität lehrende Philosoph Wolfgang Kersting thematisiert insbesondere Fragen zurr politischen Philosophie. Moralphilosophie dürfe sich nicht anmaßen, die Menschen moralisch zu belehren; vielmehr müsse sie sich damit begnügen, das bereits vorhandene Moralwissen des common sense begrifflich aufzuklären. Für diesen kritischen, philosophischen Diskurs ruft er eine Reihe von historischen Zeugen auf und fragt nach den aktuellen Bedingungen und Wirklichkeiten zu den Zusammenhängen von Macht und Moral[47].
Das Kreativitätspositiv
„Sei kreativ – und du bist erfolgreich!“ – das ist die Botschaft, die überall wo Menschen handeln, sich bewegen und entfalten ertönt[48]. Creare, das schöpferische Tun, hat seit Jahrtausenden einen süßen Klang, wie gleichzeitig ein Versprechen, dass kreatives Schaffen Menschsein zu ungeahnten Höhen befördert, Emanzipation und Freiheit ermöglicht und zu einer „Ästhetisierung des Sozialen“ führt. Im gesellschaftskritischen, wissenschaftlichen Diskurs ergibt sich dabei ein Spagat, der sich zwischen Faszination, Unbehagen und Distanz bewegt. Die Chance wie der Zwang zur Kreativität bringen dabei gewollte und ungewollte Aufforderungen und Herausforderungen mit sich. Bei der Frage, was Kreativität ist, wie sich dieses individuelle und soziale Phänomen im Menschsein darstellt, welche Herausforderungen, Erwartungen, Erfolge wie auch Enttäuschungen und Misserfolge sich zeigen, erwächst nicht selten das befreiende wie frustrierende Aha-Erlebnis: „Everything has been done“ (Grupo Azorro, 2003). Immer aber entsteht dabei der Anspruch, aus Bestehendem Neues zu schaffen und weiter zu entwickeln. Andreas Reckwitz nimmt sich diese Fragen vor. Er spürt den im wissenschaftlichen Diskurs avisierten Annahmen und Analysen nach und bringt neue Bedeutungen von kreativem Denken und Handeln ins Spiel: „Zum einen verweist sie auf die Fähigkeit und die Realität, dynamisch Neues hervorzubringen…, zum anderen nimmt Kreativität Bezug auf ein Modell des ‚Schöpferischen, das sie an die moderne Figur des Künstlers, an das Künstlerische und Ästhetische insgesamt zurückbindet“, ein Denkansatz, der für unsere Frage nach dem Guten bedeutsam ist[49]
Selbstachtung
Zur Selbstachtung gehören immer zwei: Ich und Du! Damit ist schon ausgedrückt, dass die Eigenschaft, die eigene Menschenwürde zu erkennen, zu haben und in Anspruch zu nehmen, immer verbunden sein muss mit der Haltung, die andere Individuen und Gesellschaften mir entgegen bringen und ermöglichen. Alle Philosophen haben zu allen Zeiten das „Selbst“ als einen Wert an sich definiert. Seit der Frage Platons, was etwas in Wahrheit und Wirklichkeit ist (tí poté estín), wird die Suche nach der eigenen Identität und dem Sosein des Menschen in immer neuen Variationen und Denkkonstrukten bedacht und benannt. Selbstachtung hat also etwas zu tun mit dem individuellen Selbst- und Lebenswert und den kulturellen Identitäten der Menschen insgesamt, und dem Selbstbewusstsein, das stetig und mühsam entwickelt, erarbeitet und verteidigt werden muss. Im philosophischen und wissenschaftlichen Denken hat Selbstachtung selbst referentielle und selbst steuernde Bedeutung, die die Selbst- und Fremdbeobachtung bedingt. Es ist hilfreich, will man sich des eigenen Selbstwertgefühls versichern, der biologischen, anthropologischen und gesellschaftlichen wie persönlichen Voraussetzungen für Selbstachtung bewusst zu werden. Denn falsch verstandene, ideologisch gesetzte und historisch entstandene Formen von (so genannter) Selbstachtung können leicht (und sogar selbstverständlich und nicht problematisiert) zu negativen Ausprägungen, wie Egoismus, Überheblichkeit, Selbstüberschätzung und Höherwertigkeitsvorstellungen gerinnen. Da ist es gut, sich der philosophischen Bedeutung des Menschenwerts „Achtung“ bewusst zu werden und zu fragen, wie Selbstachtung von verwandten Begriffen unterschieden werden kann, wie sich die Eigenschaft in der menschlichen Natur ausprägt und sich rechtlich und moralisch darstellt, und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn sich die Fähigkeit zur Selbstachtung durch negative Entwicklungen entweder nicht entfalten kann, oder ge- und zerstört wird. Am besten beginnt man dabei mit den individuellen, alltäglichen Erfahrungen, und greift aus auf die lokalen und globalen gesellschaftlichen und politischen Bedingungen in der Welt. Weil der grundsätzlich selbstverständlich erscheinende kategorische Imperativ – dass, wie es im Volksmund heißt, was du nicht willst, dass man dir tu´, das füg´ auch keinen andern zu – nicht selbstverständlich ist, sondern in der Familie, Schule, Beruf und Alltagsleben erworben werden muss, bedarf es der Bildung zur Selbstachtung. Der an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch-Gmünd lehrende Philosoph und Ethiker Franz Josef Wetz, geht mit seinem Buch „Rebellion der Selbstachtung“ die Thematik praktisch-pädagogisch und didaktisch an. In einer Zeitanalyse nimmt er sich vier aktuelle Krisensituationen als „Leiden der Gegenwart“ vor: Den islamistischen Terror, die globalen Aufstände gegen Entmündigung und Staatswillkür, den überreizten und ausgreifenden Individualismus in den westlichen Kulturen, und die Gleichgewichtsstörungen im Work-Life-Balance. Wie die schwierige Tugend „Selbstachtung“ gelebt werden kann, vermittelt der Autor in anschaulichen, historischen und Alltagsbeispielen![50]. Autor
Dr. Jos Schnurer
Ehemaliger Lehrbeauftragter an der Universität Hildesheim
E-Mail Mailformular
[1] Heinz Berthold, Seneca. Vom glücklichen Leben, Insel-Verlag, Tb 1457, 1992, 206 S.
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Gute
[3] in: nmz. Hochschulmagazin, 6/2015, S. 5
[4] Lawrence LeShan, Das Rätsel der Erkenntnis. Wie Realität entsteht, 2012, zur Rezension
[5] Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung, zur Rezension; sowie: Christian Gudehus / Ariane Eichenberg / Harald Welzer, Hrsg., Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Handbuch, 2010, zur Rezension
[6] Eva Hartmann / Caren Kunze / Ulrich Brand, Hrsg., Globalisierung, Macht und Hegemonie. Perspektiven einer kritischen Internationalen Politischen Oekonomie, 2009, zur Rezension.
[7] Deutsche UNESCO-Kommission, Unsere kreative Vielfalt. Bericht der Weltkommission „Kultur und Entwicklung“ (Kurzfassung), 2. erweit. Ausgabe, Bonn 1997, S. 18
[8] Deutsche UNESCO-Kommission, Menschenrechte. Internationale Dokumente, Bonn 1981, S. 48ff
[9] Kurt Bayertz: Der aufrechte Gang. Eine Geschichte des anthropologischen Denkens, 2013, zur Rezension
[10] Dieter Birnbacher, Tun und Unterlassen, 2014, zur Rezension
[11] Jos Schnurer, Ordnung ist das halbe Leben, 19.06.2015, www.sozial.de (Schnurers Beiträge); sowie: Ulrich Menzel, Die Ordnung der Welt. Imperium oder Hegemonie in der Hierarchie der Staatenwelt, 2015, zur Rezension
[12] Anton Pelinka, Hrsg., Vorurteile. Ursprünge, Formen, Bedeutung, 2012, zur Rezension
[13] Asfa-Wossen Asserate, Deutsche Tugenden. Von Anmut bis Weltschmerz, 2012, zur Rezension
[14] Peter Münch, Mozart als Blockadebrecher, in: SZ, Nr. 102 vom 4.5.2011, S. 1
[15] Avishai Margalit Über Kompromisse - und faule Kompromisse, 2011, zur Rezension
[16] vgl. z. B.: Wolfgang Huber, Ethik. Die Grundfragen unseres Lebens von der Geburt bis zum Tod, 2013, zur Rezension
[17] Peter Bieri, Eine Art zu leben. Über die Vielfalt menschlicher Würde, 2013, zur Rezension
[18] Ulrich Beck, Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 2007, 439 S.; sowie: Markus Holzinger / Stefan May / Wiebke Pohler, Weltrisikogesellschaft als Ausnahmezustand, 2010, zur Rezension
[19] Herfried Münkler, Hrsg., Handeln unter Risiko. Gestaltungsansätze zwischen Wagnis und Vorsorge, 2010, zur Rezension
[20] Manfred Lütz, Bluff! Die Fälschung der Welt, 2012, zur Rezension
[21] Gerd Gigerenzer, Risiko. Wie man die richtigen Entscheidungen trifft, 2013, zur Rezension
[22] vgl. dazu auch: Jürgen Straub, Hrsg., Der sich selbst verwirklichende Mensch. Über den Humanismus der humanistischen Psychologie, 2012, zur Rezension
[23] Abraham H. Maslow, Jeder Mensch ist ein Mystiker. Impulse für die seelische Ganzwerdung, 2014, zur Rezension
[24] Antonio Damasio, Selbst ist der Mensch. Körper, Geist und die Entstehung des menschlichen Bewusstseins, 2011, zur Rezension
[25] Maxi Berger / Tobias Reichardt / Michael Städtler, Hrsg,, „Der Geist geistloser Zustände“. Religionskritik und Gesellschaftskritik, 2012, zur Rezension
[26] Bruno Latour, Jubilieren. Über religiöse Rede, 2011, zur Rezension
[27] Dieter Kozlarek, Moderne als Weltbewusstsein. Ideen für eine humanistische Sozialtheorie in der globalen Moderne, 2011, zur Rezension
[28] siehe auch: Hans Joas, Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte, 2011, zur Rezension ders.: Hans Joas, Sind die Menschenrechte westlich? 2015, zur Rezension
[29] John Gray, Wir werden sein wie Gott. Die Wissenschaft und die bizarre Suche nach Unsterblichkeit, 2012, zur Rezension
[30] Richard Edtbauer / Alexa Köhler-Offierski, Hrsg., Welt- Geld – Gott, 2012, zur Rezension; sowie: Volker Gerhardt, Der Sinn des Sinns. Versuch über das Göttliche, zur Rezension
[31] Rahel Jaeggi / Daniel Loick, Hrsg., Nach Marx. Philosophie, Kritik, Praxis, 2013, zur Rezension
[32] Richard Sennet, Zusammenarbeit. Was unsere Gesellschaft zusammenhält, 2012, zur Rezension
[33] Martina Franzen / Alena Jung /, David Kaldewey / Jasper Korte, Hrsg., Autonomie revisited. Beiträge zu einem umstrittenen Grundbegriff in Wissenschaft, Kunst und Politik, 2014, zur Rezension
[34] Martin Hartmann, Die Praxis des Vertrauens, 2011, zur Rezension
[35][35] Markus Weingardt, Hrsg., Vertrauen in der Krise. Zugänge verschiedener Wissenschaften, 2011, zur Rezension
[36] Ute Frevert, Vertrauensfragen. Eine Obsession der Moderne, 2013, zur Rezension
[37] Sylke Bartmann / Oliver Immel, Hg., Das Vertraute und das Fremde. Differenzerfahrung und Fremdverstehen im Interkulturalitätsdiskurs, 2012, zur Rezension
[38] Philippe Pozzo di Borgo / Laurent de Cherisey / Jean Vanier, Ziemlich verletzlich, ziemlich stark. Wege zu einer solidarischen Gesellschaft, 2012, zur Rezension
[39] Silke Helfrich / Heinrich-Böll-Stiftung, Hrsg., Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat, 2012, zur Rezension
[40] Thomas Lühr,: Prekarisierung und Rechtspopulismus?. Lohnarbeit und Klassensubjektivität in der Krise, 2011, zur Rezension
[41] Ronald Lutz / Corinna Frey, Hrsg., Poverty and poverty reduction. Strategies in a global and regional context, 2011, zur Rezension
[42] Ian Morris, Wer regiert die Welt? Warum Zivilisationen herrschen oder beherrscht werden, 2011, zur Rezension
[43] Dominique Grisard / Ulle Jäger / Tomke König, Hrsg., Verschieden sein. Nachdenken über Geschlecht und Differenz, 2013, zur Rezension
[44] Daniel Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken, 2014, zur Rezension
[45] Arno Gruen, Wider den Gehorsam, 2014, zur Rezension; sowie: Rainer Lehmann: Aufforderung zum Ungehorsam. Ein Pamphlet, 2013, zur Rezension
[46] Daniel Hechler, Alex Philipps, Hg., Widerstand denken. Michel Foucault und die Grenzen der Macht, Bielefeld 2008, zur Rezension
[47] Wolfgang Kersting, Macht und Moral. Studien zur praktischen Philosophie der Neuzeit, 2010, zur Rezension; sowie: Hans Jürgen Krysmanski, Hirten & Woelfe. Wie Geld- und Machteliten sich die Welt aneignen oder: Einladung zum Power Structure Research, 2014, zur Rezension; sowie: Joseph Nye, Macht im 21. Jahrhundert. Politische Strategien für ein neues Zeitalter, 2011, zur Rezension
[48] Siegfried Preiser / Nicola Buchholz, Kreativität, 2008, zur Rezension
[49] Andreas Reckwitz, Die Erfindung der Kreativität, 2012, zur Rezension
[50] Franz Josef Wetz, Rebellion der Selbstachtung. Gegen Demütigung, 2014, zur Rezension




